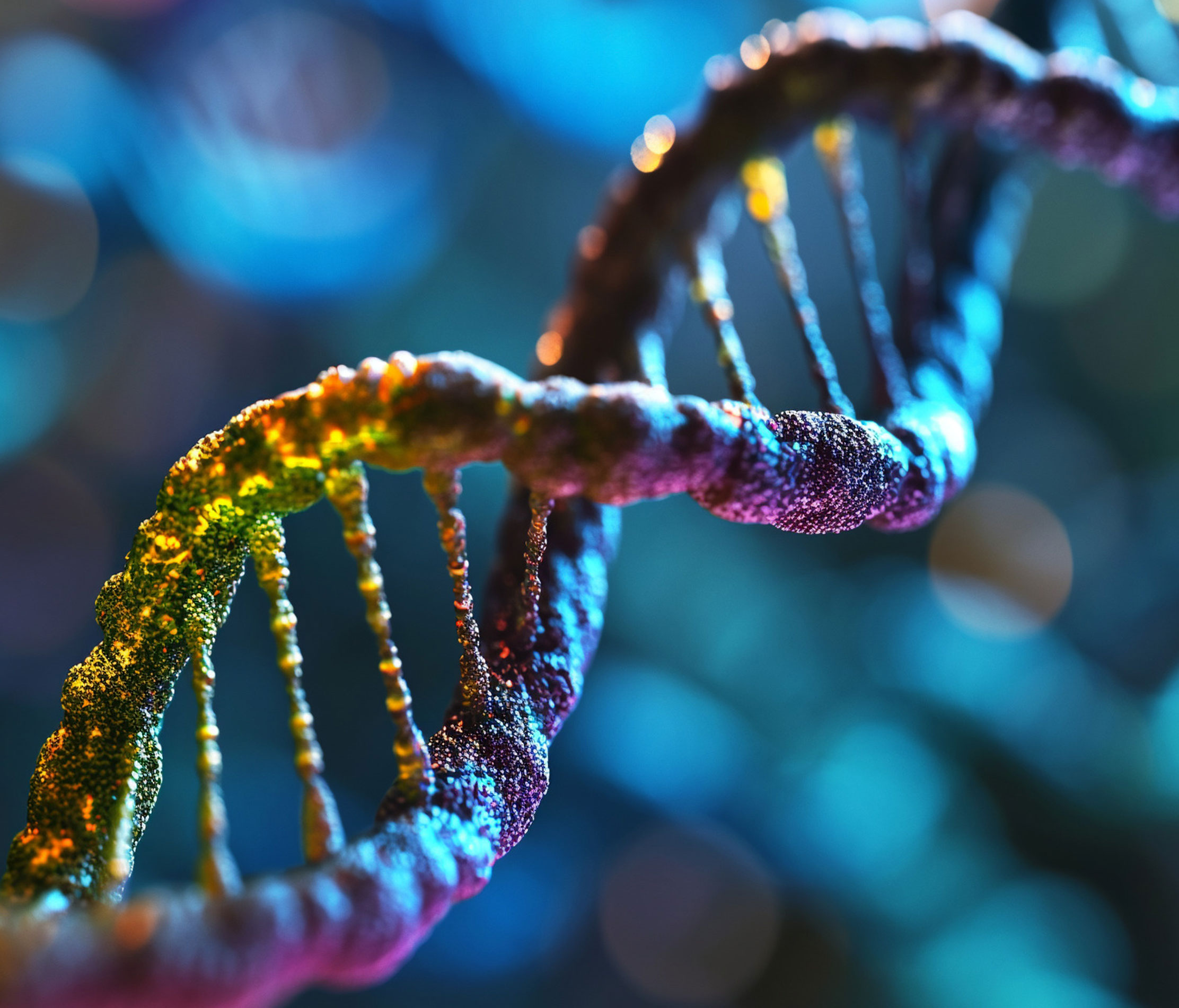Wie seltene Krankheiten
bei Kindern diagnostiziert
werden
Eine seltene Krankheit zu diagnostizieren, setzt Fachwissen von Kinderärzt:innen, eine gute Teamarbeit zwischen Spezialist:innen und ein weltweites Forschungsnetzwerk voraus. Trotz modernen Methoden kann jedoch noch immer nicht jeder Krankheit ein Name gegeben werden. Die Leitende Ärztin am Universitäts-Kinderspital Zürich, Prof. Dr. med. et phil. nat. Marianne Rohrbach, gewährt Einblick in das Fachgebiet der medizinischen Genetik.

Prof. Dr. med. et phil. nat. Marianne Rohrbach ist Leitende Ärztin am Universitäts-Kinderspital Zürich. Ihre Fachgebiete sind angeborene Stoffwechselkrankheiten, hereditäre Krankheiten des Bindegewebes und medizinische Genetik. Sie ist zudem Privatdozentin für pädiatrische Stoffwechselmedizin.
In der Schweiz sind rund 350 000 Kinder und Jugendliche von einer seltenen Krankheit betroffen. Sie erhalten in Spezialsprechstunden der Kinderspitäler Betreuung und Beratung. Dabei kümmern sich die Fachpersonen immer um die Anliegen der gesamten Familie, denn betroffen sind nicht nur die Patient:innen und die Eltern, sondern auch Geschwisterkinder und weitere Angehörige. Die Universitätsspitäler sind an ein Zentrum für seltene Krankheiten angebunden und verfügen über gezielte Forschungsprogramme zur Unterstützung der Diagnostik. So haben sie Zugang zur weltweiten aktuellen Forschung der einzelnen Krankheiten.
Im Rahmen der Früherkennung testet man in der Schweiz bereits Neugeborene auf elf behandelbare und zeitkritische Krankheiten. Dazu werden wenige Tropfen Blut aus der Ferse auf einem Filterpapier im Labor in Zürich untersucht. Bei einem auffälligen Befund wird die Familie informiert und die Behandlung so schnell wie möglich eingeleitet. Die Mehrheit der Kinder wird jedoch von Kinderärztinnen und Kinderärzten mit einem Verdacht auf eine seltene Krankheit an die Spezialsprechstunde überwiesen. Das setzt voraus, dass niedergelassene Pädiater:innen und Fachpersonen auf Notfall- und Bettenstationen eine seltene Krankheit überhaupt als solche erkennen und diagnostizieren. Damit sie stets auf dem neusten Stand sind, ist eine regelmässige Weiterbildung unerlässlich. «Hat ein Kind chronische Symptome, sollten Kinderärztinnen und Kinderärzte immer auch an eine seltene Krankheit denken», sagt Prof. Dr. med. et phil. nat. Marianne Rohrbach. Sie ist Leitende Ärztin am Universitäts-Kinderspital Zürich und spezialisiert auf medizinische Genetik.
Genanalysen liefern Antworten
«Genetische Untersuchungen sind ein fester Bestandteil der Diagnostik seltener Erkrankungen. Sie werden sowohl zur Sicherung einer biochemisch gestellten Diagnose als auch zur Bestätigung einer Verdachtsdiagnose, einschliesslich der Differentialdiagnose, eingesetzt», sagt Marianne Rohrbach.
Für eine Diagnosestellung reiche meistens eine Analyse einzelner Gene. «Ein komplettes Screening aller Gene, ein sogenanntes Whole Genome Sequencing, ist selten sinnvoll und ist noch immer sehr teuer. Ich vermute aber, dass es in naher Zukunft zum Standard wird», so die Ärztin.
«Ein Diagnoseprozess bei einer seltenen Krankheit ist Teamarbeit.»
Wird eine genetische Ursache für eine Krankheit gefunden, kann das Kind im Idealfall behandelt werden. Eine Diagnose hat aber immer auch Auswirkungen auf die restlichen Familienmitglieder und beeinflusst etwa die weitere Kinderplanung. Sie kann unter Umständen auch Ängste bei Geschwisterkindern und weiteren Verwandten schüren. «Es ist wichtig, dass die Ärzt:innen viel Fingerspitzengefühl in der Kommunikation beweisen, denn solche Diagnosen sind für alle Beteiligten äusserst schwierig», sagt Marianne Rohrbach.
Eltern spielen wichtige Rolle
Bevor eine genetische Untersuchung allerdings überhaupt vorgenommen wird, klären die Spezialist:innen die betroffene Familie über das Vorgehen auf. Sie zeigen dabei Möglichkeiten und Grenzen sowie die möglichen Konsequenzen auf. Stimmt die Familie der Untersuchung zu, wird
dem Kind, und je nach Fragestellung auch weiteren Familienmitgliedern, Blut entnommen. Mit hochspezialisierten technischen Methoden suchen Spezialist:innen im Labor anschliessend nach Abweichungen in der Erbsubstanz (DNA) eines bestimmten Gens, einer Gengruppe oder im gesamten
Erbgut. Es gleicht oft der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, ist technisch sehr aufwendig und erfordert ein hohes Spezialwissen und Erfahrung der Fachpersonen. Finden die Spezialist:innen eine Veränderung in der DNA, müssen sie zunächst prüfen, ob diese tatsächlich eine krankheitsauslösende Relevanz hat oder ob es sich möglicherweise um eine Genvariante ohne Relevanz für die Symptome handelt. Finden die Fachpersonen tatsächlich eine DNA-Veränderung, die sie als krankheitsverursachend einstufen, tragen sie dies in anonymisierter Form in eine Datenbank ein, um den Wissensstand weltweit ständig aktuell zu halten.
«Ein Diagnoseprozess bei einer seltenen Krankheit ist Teamarbeit», betont Rohrbach. Um das kranke Kind herum formiert sich jeweils ein interprofessionelles Team, zu dem auch die Eltern gehören; sie spielen darin eine wichtige Rolle. Denn sie kennen ihr Kind am besten. «Wir sagen an unseren Schulungen oft: Hört den Eltern gut zu! Denn mit einer ausführlichen Schilderung dessen, was
ihnen an den Kindern auffällt, helfen sie schon sehr viel weiter», sagt die Ärztin und Dozentin und fügt an: «Auch durch eine motivierende Begleitung der Kinder auf dem «Ein Diagnoseprozess bei einer seltenen Krankheit ist Teamarbeit», betont Rohrbach. Um das kranke Kind herum formiert sich jeweils ein interprofessionelles Team, zu dem auch die Eltern gehören; sie spielen darin eine wichtige Rolle. Denn sie kennen ihr Kind am besten. «Wir sagen an unseren Schulungen oft: Hört den Eltern gut zu!
Denn mit einer ausführlichen Schilderung dessen, was ihnen an den Kindern auffällt, helfen sie schon sehr viel weiter», sagt die Ärztin und Dozentin und fügt an: «Auch durch eine motivierende Begleitung der Kinder auf dem oft langen Weg zur Diagnosestellung unterstützen Eltern den Prozess. Es ist wichtig, der Familie als Ganzes bei zustehen und sie durch transparente und verständliche
Kommunikation sowie psychologische Unterstützung durch diese herausfordernde Zeit zu begleiten.»
Herausforderungen bei Diagnosestellung
Auf dem Weg zu einer Diagnose begegnen die behandeln den Personen und die betroffenen Familien zahlreichen Herausforderungen. Marianne Rohrbach fasst zusammen: «Die Symptome seltener Krankheiten sind oft unspezifisch und die Krankheit verläuft häufig schleichend. Mit anderen Worten: Nicht alle Symptome, die auf die Krankheit passen, sind von Anfang an sichtbar, und oft kommen Begleitsymptome hinzu, die nichts oder nicht eindeutig mit der zugrunde liegenden Krankheit zu tun haben.
Zudem ist das Wissen über seltene Krankheiten weltweit verstreut. Es kommt vor, dass es in der ganzen Schweiz keine einzige weitere Person mit derselben Krankheit gibt. In einem solchen Fall arbeiten wir im Kinderspital Zürich in internationalen Netzwerken weiter.»
Eine weitere Herausforderung ist, dass für seltene Krankheiten häufig keine funktionierenden Suchtests existieren und deshalb teure spezifische diagnostische Tests notwendig sind. Deren Kosten werden jedoch nicht immer von den Krankenkassen übernommen. Die Antragsverfahren sind langwierig und erfordern zusätzlichen administrativen Aufwand aufseiten der behandelnden Fachpersonen.
Ist schliesslich eine Diagnose da, folgen weitere Hürden: denn für gewisse seltene Krankheiten existieren noch keine wirksamen Therapien. Bei anderen gibt es zwar Therapiemöglichkeiten, die Kostenübernahme muss aber ebenfalls separat beantragt werden. Lehnt die Krankenkasse oder die IV die Kostenübernahme ab, stehen die betroffenen Familien in dieser belastenden Situation zusätzlich vor finanziellen Herausforderungen.
Klarheit und bessere Planungssicherheit
Kann eine Diagnose gestellt werden, ist das oft eine Erleichterung für die betroffene Familie, denn so erhält das diffuse Krankheitsbild einen konkreten Namen. Wenn dadurch sogar eine Behandlung möglich wird, gibt das der Familie Hoffnung. Manchmal werden diese Hoffnungen aber auch zerschlagen. «Leider haben wir heute noch immer für viele Krankheiten keine Behandlung oder keine
Heilungsansätze. Dennoch bedeutet die Diagnose für die betroffenen Familien, dass sie nun wissen, worum es sich handelt, wie die Krankheit verläuft, welche unterstützenden Therapien im Umgang mit der Krankheit helfen können, und nicht zuletzt: Sie können sich mit anderen betroffenen Familien in der Schweiz, aber auch weltweit, austauschen», so Marianne Rohrbach. Mit der Diagnose einer seltenen Krankheit ist oft auch eine genetische Beratung verbunden, die sich mit dem Wiederholungsrisiko der verschiedenen Vererbungswege befasst. Auch dies kann eine grosse Erleichterung für die Familien sein, da sie sich bei der weiteren Familienplanung nun auf Fakten stützen können.
«Es kommt vor, dass es in der ganzen Schweiz keine einzige weitere Person mit derselben Krankheit gibt.»
Was, wenn die Diagnose fehlt?
Hin und wieder kommt es vor, dass trotz allen Untersuchungen keine Diagnose gestellt werden kann. Sei es, weil es sich um eine Krankheit handelt, die man mit dem heutigen Wissensstand nicht diagnostizieren kann. Das ist für alle Beteiligten frustrierend und unbefriedigend. Keine Diagnose zu haben, belastet die Familien. Es herrscht einerseits Unklarheit über das Wiederholungsrisiko für die weitere Familienplanung. Andererseits erhalten die Betroffenen dadurch keinerlei Unterstützung
durch die IV.
Auch die Unsicherheit hinsichtlich des Krankheitsverlaufs belastet sehr, und die Familien können sich nicht mit anderen Betroffenen austauschen. Das Kinderspital Zürich behandelt Kinder auch ohne Diagnose – und stimmt in diesem Fall die Therapien auf die einzelnen Symptome ab. Die Kinder werden jedoch weiterhin nach einer Diagnose suchen müssen – oft bis ins Erwachsenenalter.
Die Ärztinnen und Ärzte werden die Symptome immer wieder neu bewerten und diese stets mit neu beschriebenen Krankheiten vergleichen, bis sie eines Tages – hoffentlich – Klarheit haben und dem Kind eine Diagnose stellen können.
Hier erhalten Sie Unterstützung bei einer seltenen Krankheit
Die Helpline für seltene Krankheiten Zürich ist eine unabhängige Dienstleistung für Kinder und Erwachsene sowie Fachpersonen. Sie hilft Betroffenen in dieser oft herausfordernden Situation und unterstützt sie bei der Suche nach Hilfe und Informationen.
Tel. +41 (0) 44 249 65 65
Das Zentrum für seltene Krankheiten Zürich ist eine fachübergreifende Zusammenarbeit
zwischen dem Universitäts-Kinderspital Zürich, dem Universitätsspital Zürich, der Universitätsklinik Balgrist sowie dem Institut für medizinische Genetik der Universität Zürich. Ihr Ziel ist es, die Versorgung für Patientinnen und Patienten mit einer seltenen Krankheit zu verbessern und diejenigen, welche noch ohne Diagnose sind, bestmöglich im Prozess bis zur Diagnosestellung zu unterstützen.
E-Mail: zszk@kispi.uzh.ch
www.usz.ch/fachbereich/zentrum-seltene-krankheiten
Die Nationale Koordination seltene Krankheiten (kosek) ist eine Koordinationsplattform für die Verbesserung der Versorgungssituation für Betroffene von seltenen Krankheiten.
www.kosekschweiz.ch
Das Schweizerische Register für seltene Krankheiten (SRSK) ist ein nationales Register für seltene Krankheiten. Das SRSK erfasst Angaben zu möglichst allen Personen mit einer seltenen Krankheit, die in der Schweiz leben und/oder behandelt werden.
www.raredisease.ch
Der Dachverband ProRaris vertritt und wahrt die Interessen von betroffenen Patient:innen mit seltenen Krankheiten und deren Organisationen.
www.proraris.ch
Der gemeinnützige Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten (KMSK) begleitet
Familien mit kontinuierlichem Wissenstransfer zum Thema seltene Krankheiten bei Kindern
und bietet finanzielle Unterstützung.
www.kmsk.ch
Text: Carola Fischer
Fotos: zvg, Adobe Stock